“Citizen science illuminates the nature of city lights”: citizen scientists insights into the research project “Nachtlichter”
Published in Earth & Environment

Description and significance of our research
Unseren deutschen Text finden Sie im Anschluss. (German below)
Nachtlicher means “night lights”, and it is a co-designed project and app for research about light pollution. Co-design means that people with different levels of scientific expertise, including citizen scientists with or without academic backgrounds, work together on a project.
Our cover shows artificial lighting at night (light pollution) from street lamps, signs and façade lighting. The enlarged image shows people recording data with our app.
(Foto: Steffen Lohse)
The fundamental sources of light pollution remain largely unknown, despite the existence of satellite measurements and streetlighting cadastres (maps). The Nachtlichter project addresses this missing data. We conducted what we believe to be the largest systematic survey of outdoor lighting to date. Our team developed an app, and used it in 2021 to observe and classify 234,044 light sources. This data helps to better understand the radiance (brightness) observed by a nighttime light satellite instrument called VIIRS-DNB. By combining our observations with the satellite data, we found that about 78 million light sources are still on at midnight on a typical night in Germany.
Introduction of the authors:
We are two citizen scientists that were members of the Helmholtz and BMBF funded Nachtlichter-Project. We do not have an academic background, but recently co-authored a paper about the project in Nature Cities as part of “Team Nachtlichter”, and are pleased to share our experiences in a research project on light pollution. Brita joined the project because she knew someone from the organizational team, and wanted to support the team as a citizen scientist. She found it very interesting to gain an insight into scientific work.
Eva loves observing the stars, and heard about a different app (Loss of night) that allows you to collect data on light pollution by observing stars in a podcast. That led her to eventually joining the team accidentally. Our blog post does not differentiate between our two experiences, but reflects different personal focuses and perspectives. Our project leader, Christopher Kyba, helped us translate this text.
The project process
When we first started joining the project’s online meetings, it took a while to understand everything. For example, it wasn’t even clear to us initially who in the group had an academic background, and who was participating as a citizen scientist. We also needed time to figure out what was expected of us, and how we could best contribute.
One thing that really surprised us both was that everyone’s opinion was treated with equal weight by the group; Nachtlichter really was (and is) a collaborative project. In the end, there were many different possible ways to participate. About two dozen people organized large light counting campaigns in their hometowns, and part of the co-design team got involved in data analysis. Several team members gave presentations about the project, including at academic meetings. We have also written a text for non-academics to accompany our publication.
How did we take part
One of the first processes in which we were actively involved was the development of a paper template for recording the different types of lighting we saw while walking along the individual streets. This task was already fascinating. Our group used this template to develop the lighting categories that were used in the Nachtlichter app.
The feeling of being able to ask (even basic) questions helped to improve the project, because our questions often turned out to be important. We made sure that people with disabilities could participate in our project. The app was designed to be usable by people with color vision impairment, and the tutorial was entirely visual, to ensure hearing-impaired people could participate.
Because Nachtlichter is a German research project, we felt the results should also be accessible to people who do not speak English. Our group therefore decided we should have a German language summary of our “methods paper”, and the two of us wrote the first draft together. This experience gave us a taste of what we expect it must feel like to be responsible for a scientific publication.
High points and surprises
Nachtlichter is together with our sister group “Fireball” part of a larger project called “Nachtlicht-BüHNE”. After almost 3 years of Zoom meetings, we finally had the chance to meet people from both teams in person at a workshop in the International Dark Sky Community Fulda. We enjoyed experiencing the lighting concept of the city of Fulda, which we felt conveyed a feeling of both safety and comfort. We took a short trip to the neighboring town of Gersfeld, which completely switches off its street lighting late in the evening. We were all excited to experience the moment that the lights went out.
Both of us were surprised to learn how extensive light pollution research is: even trees and fish, for example, are negatively affected by artificial lighting.
Seeing our own names on a scientific publication for the first time was a very special moment. We also appreciated what for us felt like a “behind the scenes look at how science works”, by attending conferences. We were each honored to be included as speakers in the German “Forum Citizen Science” conference series, and enjoyed speaking to the public as part of the “Long Night of Science” in Potsdam, and as part of the “Universe on Tour” science roadshow.
Aftermath:
At the beginning of the project, Eva was worried that “without light, I won't feel comfortable”. This feeling changed as a result of participation, by realizing that good lighting that takes both nature and human needs into account is possible. We hope to spread this knowledge. Brita became involved in her city's sustainability network. She presented the Nachtlichter project there, hoping to promote more sustainable lighting in her community.
Nachtlichter demonstrates that, with the right training, citizen science can produce high-quality data. We therefore call on researchers and funding agencies to involve more citizens in scientific projects. We believe participation in science creates interest in research, and that having the experience of being a citizen scientist promotes trust in science.
Watch our Project on Youtube: https://youtu.be/OhNa-d3HcKc
DEUTSCH
Blick hinter die Kulissen:
“Citizen science illuminates the nature of city lights”: bürgerwissenschaftliche Einblicke in das Forschungsprojekt “Nachtlichter”
Kurze Beschreibung
Nachtlichter (nighttime lights) ist ein Co-Design-Projekt. Wir untersuchen die Ursachen von künstlicher Beleuchtung in Städten, um Lichtverschmutzung besser zu verstehen.
Als Citizen Scientists präsentieren wir unsere Perspektive auf den Forschungsprozess vom Entwurf bis zur Veröffentlichung.
Darstellung und Bedeutung unserer Forschung
“Nachtlicher“ ist ein Co-Design-Projekt und eine App zur Erforschung der Lichtverschmutzung. Co-Design bedeutet, dass Menschen mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Kenntnissen, einschließlich Bürgerwissenschaftler*innen mit oder ohne akademischen Hintergrund, gemeinsam an einem Projekt arbeiten.
Unser Titelbild zeigt künstliche nächtliche Beleuchtung (Lichtverschmutzung) von Straßenlampen, Leuchtreklame und Fassadenbeleuchtung. Das vergrößerte Bild zeigt Personen, die mit der App Daten erfassen. (Foto: Steffen Lohse)
Ausmaß und Ursachen von Lichtverschmutzung sind größtenteils unbekannt, trotz vorhandener Satellitenmessungen und Kataster (Karten) der Straßenlaternen. Hier setzte das Nachtlichter-Projekt mit der, wie wir glauben, bisher größten systematischen Erfassung von künstlicher Beleuchtung an.
Das Nachtlichter-Team hat eine App entwickelt mit der 234.044 Lichtquellen im Jahr 2021 in 18 verschiedenen Kategorien erfasst wurden. Diese Daten helfen, die von einem Satellit mit dem Instrument namens VIIRS-DNB zur Beobachtung von Nachtlichtern gemessene Strahldichte (sozusagen “Helligkeit”) besser zu verstehen.
Indem unsere Daten mit den Satellitendaten kombiniert wurden, konnte herausgefunden werden, dass um Mitternacht noch typischerweise 78 Millionen Lichtquellen in Deutschland scheinen.
Die Autorinnen stellen sich vor:
Wir sind zwei Bürgerwissenschaftlerinnen in dem von der Helmholtz-Gemeinschaft und vom BMBF finanzierten Nachtlichter-Projekt. Wir haben keinen akademischen Hintergrund, aber als Co-Autorinnen im “Team Nachtlichter” kürzlich einen Forschungsbericht über das Projekt in Nature Cities veröffentlicht.
Wir teilen unsere Erfahrungen im Projekt Nachtlichter zur Forschung über das Thema Lichtverschmutzung.
Brita kannte jemanden aus dem Organisations-Team des Nachtlichter-Projekts und hatte Lust, das Team als Citizen Scientist (Bürgerwissenschaftlerin) zu unterstützen. Sie fand es sehr interessant, Einblick in die Arbeit der Wissenschaft zu bekommen.
Eva liebt es, die Sterne zu beobachten. In einem Podcast hörte sie von einer App (Loss of Night), mit der man mittels Beobachtung von Sternen Daten über Lichtverschmutzung erfassen kann und kam so zufällig zum Team.
Der weitere Bericht unterscheidet nicht zwischen den Erfahrungen von Brita und Eva - spiegelt aber durchaus unterschiedliche und persönliche Schwerpunkte und Perspektiven wieder. Unser Projektleiter Christopher Kyba half uns mit der Übersetzung ins Englische.
Wie war der Prozess?
Wir brauchten in den Online-Meetings erstmal Zeit, um uns zurechtzufinden:
Wer in der Gruppe hat einen akademischen Hintergrund und wer ist als Bürgerwissenschaftler*in dabei? Was sollte erreicht werden und wie konnten wir uns einbringen?
Für uns auch ein wichtiger Lernprozess war zum Beispiel, dass von Anfang an jede Meinung gleichberechtigt war. Nachtlichter war und ist ein Gemeinschaftsprojekt. Letztendlich konnten wir alle uns auf verschiedene Weise einbringen.
Ungefähr zwei Dutzend Personen haben (auch größere) Zählkampagnen in ihrem Heimatort organisiert. Ein Teil des Co-Design-Teams engagierte sich in der Datenanalyse. Etliche Team-Mitglieder hielten Vorträge über das Projekt, auch in akademischen Konferenzen. Wir haben auch einen Text für Nicht-Akademiker geschrieben, der unsere Veröffentlichung begleitet.
Wie konnten wir uns einbringen?
Einer der ersten Prozesse, wo wir uns aktiv einbringen konnten, war die Entwicklung einer Papiervorlage für die Erfassung der verschiedenen Beleuchtungsarten in den einzelnen Straßen. Diese Aufgabe war bereits sehr faszinierend. Aus dieser Vorlage wurden dann die Lichtkategorien entwickelt, die in der Nachtlichter-App verwendet wurden.
Das Gefühl grundsätzlich alles (hinter-)fragen zu können, half die Planung der einzelnen Projektschritte zu verbessern, weil sich die Fragen oft als nützlich erwiesen. Es wurde großen Wert darauf gelegt, Menschen mit Behinderung die Teilnahme an unserem Projekt zu ermöglichen. Farb-Sehbehinderte Personen konnten die App nutzen. Das Tutorial wurde visuell erklärt, um auch hörbehinderten Personen die Teilnahme zu ermöglichen. Nachtlichter ist ein deutsches Forschungsprojekt und im Gedanken der Inklusion sollten die Ergebnisse auch auf deutsch geteilt werden. Unsere Gruppe entschied deshalb, dass wir eine deutschsprachige Zusammenfassung unseres “Methodenpapiers” brauchen. Für diese konnten Eva und Brita den ersten Entwurf schreiben und erfahren, wie es sich anfühlt, "sowas wie wissenschaftliche Veröffentlichung” zu verantworten.
besondere Höhepunkte und Überraschendes:
Nachtlichter gehört zusammen mit dem Schwesterprojekt "Feuerkugel" zum Nachtlicht-BüHNE-Projekt. Nach fast 3 Jahren Zoom-Meetings gab es in einem “Vor-Ort-Workshop” die Chance, in der Sternenstadt Fulda Teammitglieder beider Projekte kennenzulernen und uns auszutauschen.
Die Stadt Fulda mit ihrem guten Beleuchtungskonzept konnte sowohl das Gefühl von Sicherheit als auch Behaglichkeit vermitteln. Wir unternahmen einen kleinen Ausflug in den Nachbarort Gersfeld. Dort wird spät abends die Straßenbeleuchtung komplett ausgeschaltet und natürlich haben wir uns “dieses Schauspiel” nicht entgehen lassen.
Es war überraschend zu erfahren, wie umfangreich das Forschungsgebiet über Lichtverschmutzung ist. Wissenschaftler erforschen sogar, wie Bäume und Fische durch künstliche Beleuchtung (negativ) beeinflusst werden.
Ein besonderer Moment war es auch, das erste Mal den eigenen Namen in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zu sehen.
Ebenso war die Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen ein "spannender Blick hinter die Kulissen”. Wir waren sehr beeindruckt, dass wir bei der deutschsprachigen Konferenzreihe “Forum Citizen Science” auch jeweils einen kurzen Vortrag halten durften. Bei “der langen Nacht der Wissenschaften” in Potsdam und der Roadshow “Universe on Tour” konnte unser Nachtlichter-Projekt der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Ausblick:
Zu Beginn des Projekts war Eva besorgt, “sich ohne Licht nicht mehr wohl zu fühlen”. Dieses Gefühl wandelte sich zu der Erkenntnis, dass “gute Beleuchtung” möglich ist, die sowohl die Natur berücksichtigt als auch menschliche Bedürfnisse.
Dieser Erkenntnisgewinn sollte auch der Gesellschaft ermöglicht werden.
Brita engagierte sich im Nachhaltigkeitsnetzwerk ihrer Stadt. Sie stellte dort das Nachtlichter-Projekt vor, auch um Änderungen der Straßenbeleuchtung zu erreichen.
Unsere Erfahrung zeigt, dass die Wissenschaft durch Citizen Science mit entsprechender Schulung auch mit hoher Qualität mehr Daten gewinnen kann.
Unser Appell an die Wissenschafler*innen und Fördergeber ist, mehr Bürger*innen in wissenschaftliche Projekte einzubinden.
Wir sind überzeugt, dass die Teilnahme in Forschungsprozessen für Interesse an der Forschung sorgt und somit Vertrauen in die Wissenschaft fördert.
Unser Projekt auf Youtube: https://youtu.be/hZo17_V_klg
Follow the Topic
-
Nature Cities

This journal aims to deepen and integrate basic and applied understanding of the character and dynamics of cities, including their roles, impacts and influences — past, present and future.


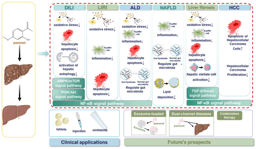

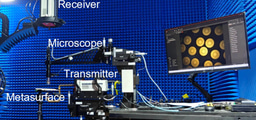

Please sign in or register for FREE
If you are a registered user on Research Communities by Springer Nature, please sign in